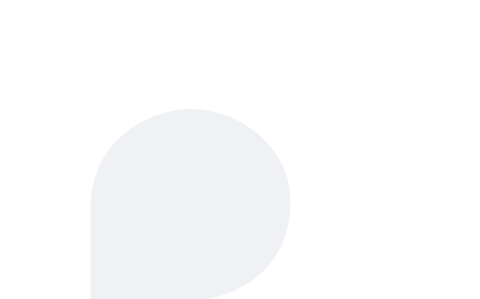Janka Vogel, seit Februar leiten Sie den Fachbereich Soziales und Migration. Sie verantworten Projekte an acht Standorten mit rund 130 Mitarbeitenden, haben Finanzierungen im Blick und halten den Kontakt zu Zuwendungsgebern und Kooperationspartnern. Wie war bisher das Ankommen in diesem vielfältigen Job?
Ich hatte einen guten Start. Sehr hilfreich war die Einarbeitung durch meine Vorgängerin Alix Rehlinger. Schöne Momente gab es schon viele, wie den Besuch der Berliner Integrationsbeauftragten bei unseren Stadtteilmüttern oder die Möglichkeit, im Bundestag auf unsere Migrationsberatung aufmerksam zu machen. Es freut mich auch sehr, dass so viele Kolleg*innen Lust auf Aufbruch haben. Ihre Kompetenz und ihr Engagement beeindrucken mich sehr. Das Beste, Wichtigste und letztlich Entscheidende sind immer die Mitarbeiter*innen und Kolleg*innen.
Sie haben unter anderem Pädagogik und Rumänistik studiert und wissenschaftlich zu Themen wie Migration, Armut oder Sozialpolitik gearbeitet. Gab es einen Schlüsselmoment, der Sie ins Feld der Migrationsberatung führte?
Meine erste Begegnung mit Migration hatte ich bei meiner Arbeit in einer Grundschule in Rumänien. Dieses Land hat mich – wie ganz Südosteuropa – in seiner Vielfalt schon immer fasziniert. Ich traf dort auf Schüler*innen, die bei Nachbarn und Großeltern lebten, weil ihre Eltern in Italien und Portugal arbeiteten. So kam es, dass ich mich für die rumänische Emigration interessierte. Einige Jahre später kam in Deutschland die Debatte um die sogenannte Armutszuwanderung auf. Seitdem war angesichts der rassistisch geführten Debatte viel Aufklärung nötig und ich fing an, neben meiner Arbeit als Migrationsberaterin, auch zur rumänischen Community in Berlin zu forschen.
Gibt es ein Thema, bei dem Sie besonderen Handlungsbedarf sehen?
Ja, unser Stadtteilmütter-Projekt. Nächstes Jahr feiern wir 20-jähriges Projekt-Jubiläum. Mich beeindruckt es, was die Kolleg*innen hier aufgebaut haben: Eine hochkomplexe, kleinteilige Projektarbeit mit dem Blick auf Familien aus migrantischen Communities. Gleichzeitig verfolgen wir mit dem Projekt eine Art Peer-to-Peer-Ansatz: Migrantinnen, die selbst Mütter sind, helfen anderen migrantischen Müttern. Was aber passiert während und vor allem nach der Beschäftigung bei uns? Unsere sechsmonatige Qualifizierung ist für manche die erste Qualifizierung überhaupt und ein ganz großer Schritt zu mehr beruflicher Eigenständigkeit. Auf dem Berliner Arbeitsmarkt aber gibt es kaum Anschlussperspektiven. Ich glaube, dass wir die sozialpädagogische Begleitung intensivieren sollten und den Fokus stärker auch auf die Entwicklung von Berufsperspektiven legen müssen. Denn erstens haben wir einen Fachkräftemangel und zweitens haben wir ein neues Partizipations- und Migrationsgesetz in Berlin, was genau das einfordert: dass mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in der Verwaltung arbeiten, und zwar (eigentlich) entsprechend ihres Anteils an der Gesamtbevölkerung. Davon ist Berlin noch sehr weit entfernt.
Sie waren sowohl als Forschende als auch in der Beratung tätig. Was davon bringen Sie in die Leitungsstelle mit ein?
Forschung und Beratung sind für mich stets aufeinander bezogen – ich glaube, ich habe ein Faible für diese möglichst enge Theorie-Praxis-Verknüpfung. Es ist wichtig, die verschiedenen Perspektiven und Herangehensweisen zu kennen. Denn Vieles, was in unserer Stadt, unserer Gesellschaft und unserem Europa nicht funktioniert, lässt sich darauf zurückführen, dass die jeweiligen Akteur*innen – Forscher*innen, Politiker*innen, Verwaltungskräfte und Sozialarbeiter*innen – sich nicht aus ihrem Bereich herausbewegt haben. Dieses Anliegen habe ich auch in der Leistungsrolle, denn gerade die Migrationsberatung und die Integrationssozialarbeit leben davon, dass wir mit verschiedenen Menschen und verschiedenen Akteur*innen in ihrer Sprache sprechen und ihre Erfahrungen wertschätzen – seien sie Zugewanderte oder Arbeitsvermittler*innen im JobCenter.
Welche Herausforderungen sehen Sie in der Entwicklung des Fachbereiches?
Wir sind fachlich enorm kompetent, im Sozialraum bestens vernetzt und eine wichtige Stimme in der Berliner Integrationsarbeit – diese gute Arbeit gilt es fortzuführen. Im Fachbereich haben wir zwei große Bereiche: die Migrationsberatungsprojekte und die „Stadtteilmütter in Neukölln“. Beide Bereiche stehen wirtschaftlich auf wackeligen Füßen, da die Angebote keine entgeltfinanzierten Regelstrukturen, sondern fehlbedarfsfinanzierte Projektstrukturen haben, das heißt wir stellen jährlich Anträge, Berichte, Verwendungsnachweise und so weiter. Die Bürokratie ist enorm und hochkomplex. Daneben müssen wir uns stetig fortbilden, da sich die Gesetzeslagen ständig ändern. Neue Zielgruppen kommen zu uns, hier müssen wir unser Mandat und Zuständigkeiten klären. Wenn Behörden überlastet sind, dauert auch unsere Bearbeitung der Einzelfälle länger. Ratsuchende sind gestresst, verzweifelt, teils falsch informiert, teils von Arbeitsausbeutung oder Menschenhandel betroffen. Das sind gleichzeitig Belastungen für die Kolleg*innen, die wir uns anschauen und bewältigen müssen.
Für das Diakoniewerk Simeon sehe ich Migration als Querschnittsthema. In unserem Fachbereich haben wir die migrationsgesellschaftliche Kompetenz, die in all unseren Arbeitsfeldern gebraucht wird. Daher hoffe ich auf mehr Verbindungen und will natürlich auch selbst dazu beitragen.