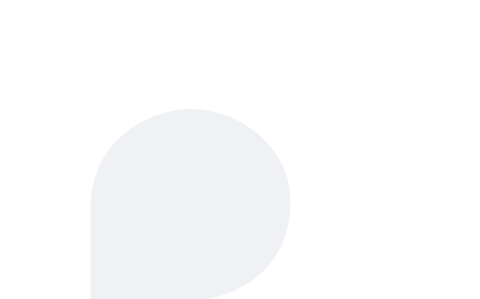Frau Krüger, Sie unterstützen erwachsene Zugewanderte und junge Menschen mit Migrationsgeschichte in Beratungsstellen in Königs Wusterhausen und Lübbenau. Was in Ihrer Arbeit hat sich seit dem Angriff auf die Ukraine verändert?
Inzwischen sind knapp die Hälfte meiner Ratsuchenden Geflüchtete aus der Ukraine. Wenn Menschen neu nach Deutschland kommen, ist unglaublich viel Papierkram zu regeln: Zuerst die Meldebescheinigung, um beim Sozialamt einen Antrag für Leistungen stellen zu können, danach die Asylantragstellung beim BAMF. Dann kommt der Wechsel zum Jobcenter. Kindergeld und Krankenkasse müssen informiert werden. Der Bedarf an dieser allgemeinen Sozialberatung ist riesig – leider gibt es davon nicht genug. Zu Beginn des Krieges haben wir einen zusätzlichen Tag nur für Ukrainer*innen eingeführt. Im Sommer konnte auch meine Arbeitszeit aufgestockt werden. Inzwischen hat es sich gut auf die übrigen Beratungstage verteilt.
Wie liefen die Anfänge?
Zuerst sind die Ehrenamtlichen auf uns zugekommen, die hier leben und bei denen die Geflüchteten privat untergekommen sind. Dadurch konnten wir viel auf Deutsch beraten. Später kamen über den Buschfunk auch Geflüchtete selbst. Zu unserem großen Glück unterstützt uns seit vielen Jahren eine russischsprachige Frau ehrenamtlich als Übersetzerin.
Wie haben sich Bedarfe der Geflüchteten über die Zeit verändert?
Der Umzug in eine eigene Wohnung wurde dringender. Anfangs war die Hoffnung, dass der Krieg schnell vorbei geht – sowohl bei den Geflüchteten als auch bei den Helfenden. Also sind alle zusammengerückt, Gästezimmer und Sofas wurden bezogen. Spätestens nach einigen Monaten wollten die Kinder ihre Zimmer zurück und auch die ukrainischen Familien brauchten Platz. Sie wurden selbstständiger, gingen wieder zur Schule oder arbeiten. Nach und nach haben die Landkreise Wohnungen zur Verfügung gestellt. Die ersten können jetzt erst in eigene Wohnungen umziehen. Dann beraten wir zum Beispiel zu Obergrenzen für die Miete. Oder wenn Gesundheitskarten immer noch nicht funktionieren oder ein Antrag auf Halbwaisenrente im Briefkasten landet. Nachdem die Grundversorgung geklärt war, beschäftigen die Menschen jetzt andere Fragen.
Welche?
Die Mütter – und das sind die meisten – vor allem: ‚Wie geht es meinen Kindern? Mache ich alles richtig? Schaffe ich das alleine?‘ Sie konzentrieren sich auf die Zukunft und das erfordert wirklich viel Kraft. Manchen fällt es schwer, sich auf das Bleiben einzulassen. Die fahren regelmäßig zurück, besuchen zum Beispiel Eltern, die noch dort sind. Es gibt einen Fall: Eine Frau hat ihre vierjährige Tochter zum Opa gebracht, der als Spätaussiedler in Deutschland lebt. Die Tochter sollte in Sicherheit aufwachsen und nicht im Kriegsland. Sie selbst ging zurück, um ihr Land zu verteidigen. Das ist natürlich für alle eine sehr belastende Situation. Auch für den Rentner, den die Erziehung seiner Enkelin ziemlich fordert. Den konnten wir an das Netzwerk Gesunde Kinder anbinden. Dadurch bekommt er eine Rückkopplung, dass es gut ist, was er macht.
Sie beraten auch junge Erwachsene. Was sind deren Themen?
Nach dem Sommer waren das besonders Schule und Ausbildung. Vorher konnte das noch irgendwie abgewartet werden, aber dann wurde es Zeit, nächste Schritte zu gehen. Und da motivieren wir, die Möglichkeiten hier in Deutschland zu nutzen. Warten ist keine Option mehr.
Wie unterstützen Sie konkret?
Wir arbeiten mit der Berufsberatung der Arbeitsagentur zusammen und vermitteln zu bestehenden Netzwerken, zum Beispiel zum Azubi-Netzwerk in Lübbenau, damit sich die Jugendlichen untereinander kennenlernen. Es ist wichtig zu erleben, dass andere die gleichen Probleme haben. Kontakte knüpfen viele auch über die Spätaussiedlergruppe in unserem Mehrgenerationenhaus in Königs Wusterhausen, gleich neben dem Jugendclub. Wir bringen hin und wieder auch Einzelpersonen direkt zueinander. Gerade sind Ehrenamtsprojekte im Entstehen, um sich untereinander zu organisieren. Auch das kann ein Schritt des Ankommens sein, wenn die Menschen bereit dafür sind – von sich selbst auf andere schauen und Erfahrungen weitergeben.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Für die Menschen aus der Ukraine natürlich, dass der Krieg aufhört! Dass sie Hoffnung haben, auch wenn vieles zerstört ist. Von den Behörden würde ich mir wünschen, dass wir als Beratende nicht als ewige Widerspruchsschreiber gesehen werden, sondern als die, die ihnen Arbeit abnehmen.